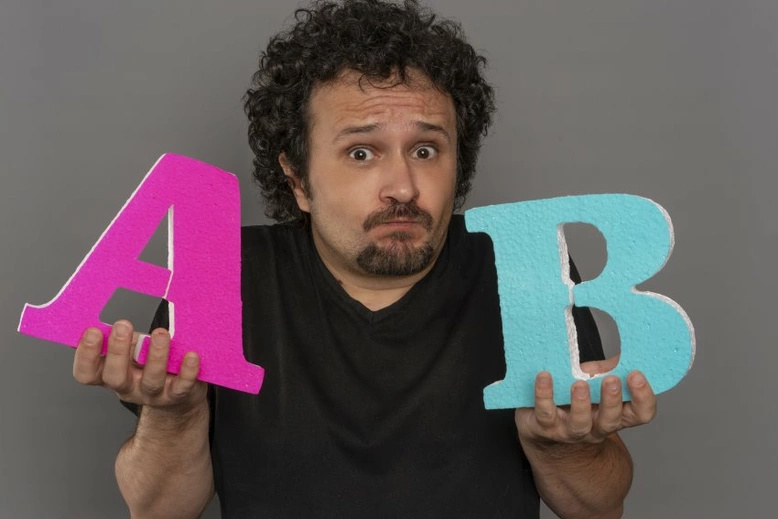
Mit dem am 1. April 2007 in Kraft getretenen GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz sollte der Wettbewerb unter den Krankenkassen gefördert werden - mit dem Ziel, bessere Leistungen und mehr Effizienz zu bewirken. Eine Maßnahme des Gesetzes zielte auf die Ausweitung der Spielräume bei Wahltarifen. Seither dürfen die Krankenkassen allen Mitgliedern auch Selbstbehalt- und Kostenerstattungstarife anbieten.
Davon wurde in der Folge rege Gebrauch gemacht. Bei einem Kostenerstattungstarif findet die Abrechnung einer Behandlung oder medizinischen Leistung nicht wie sonst über die Gesundheitskarte statt, sondern der Versicherte erhält eine Rechnung, die er selbst bezahlt und bei seiner Krankenkasse zur Kostenerstattung einreicht. Das Verfahren ist mit dem in der PKV vergleichbar und tatsächlich sind Kassenpatienten mit Kostenerstattung in vielem ähnlich gestellt wie Privatpatienten.
Continentale klagt gegen AOK Rheinland/Hamburg
Ähnlich heißt jedoch nicht gleich. Denn bei dem, was die Krankenversicherung erstattet, gibt es nach wie vor erhebliche Unterschiede. Während in der GKV nur Leistungen der medizinischen Regelversorgung übernommen werden, ist die PKV - je nach Tarif - erheblich großzügiger. Allerdings gibt es auch im Bereich der Krankenkassen Versuche, bei Kostenerstattungstarifen zusätzliche Leistungen anzubieten, was im Prinzip eine Annäherung an PKV-Tarife bedeutet. Dabei handelt es sich um eine juristische Gratwanderung mit engen Grenzen, wie ein kürzlich ergangenes Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zeigt (LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 14.06.2018, Az.: L 16 KR 251/14).
In dem Verfahren klagte die Continentale Krankenversicherung a.G., ein PKV-Anbieter, gegen die AOK Rheinland/Hamburg. Die Klage betraf verschiedene Wahltarife nach dem Kostenerstattungsprinzip, die die AOK im Zuge des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes eingeführt hatte. Bei den neuen Kostenerstattungstarifen ging es um Leistungen bei Auslandserkrankungen, für Krankenhauszuzahlungen, bei Zahnersatz oder bei Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer-Unterbringung im Krankenhaus. Später wurden auch Tarife für Zahn-Gesundheitsvorsorge, häusliche Krankenpflege, Brillen und Kieferorthopädie eingeführt.
Dabei handelte es sich letztlich um Angebote, die Kassenmitgliedern in ähnlicher Form auch im Rahmen eines privaten Krankenzusatzschutzes zugänglich sind. Die Continentale sah darin eine „Grenzüberschreitung“ und fordert von der AOK Rheinland/Hamburg die Unterlassung des Angebots. Eine von ihr eingereichte Unterlassungsklage beim Sozialgericht Dortmund wurde zunächst abschlägig entschieden, aber zur Revision zugelassen. Das Landessozialgericht gab der Continentale im Berufungsverfahren überwiegend Recht.
Eine (weitgehend) unzulässige Grenzüberschreitung
Das Gericht hielt es für unzulässig, dass die AOK Rheinland/Hamburg ihren Mitgliedern bei Kostenerstattungstarifen Zusatzleistungen anbiete, die über das für die „… Aufrechterhaltung der Gesundheitsfürsorge Gebotene und verfassungsmäßig Zulässige …“ hinaus reichten. Als Teil der öffentlichen Hand müsse sich die AOK in dem Leistungsrahmen bewegen, der in der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen sei. Wenn sie diesen Rahmen überschreite, agiere sie rechtswidrig zu Lasten privater Drittanbieter. Eine Ausnahme machte das Gericht bei den Kostenerstattungstarifen für Zahn-Gesundheitsvorsorge und häusliche Krankenpflege. Diese Tarife wurden als zulässig angesehen.
Das Urteil hat über den aktuellen Streitfall hinaus Bedeutung für die „Grenzziehung“ zwischen GKV und PKV. Von Seiten der privaten Krankenversicherer werden die Leistungserweiterungen über die Kostenerstattungstarife argwöhnisch beäugt, bedeuten sie doch eine Beeinträchtigung des eigenen Geschäftsmodells. Auch für das LSG-Urteil wurde Revision zugelassen, wovon sicher Gebrauch gemacht wird. Auf das höchstrichterliche Urteil des Bundessozialgerichts darf man gespannt sein.
