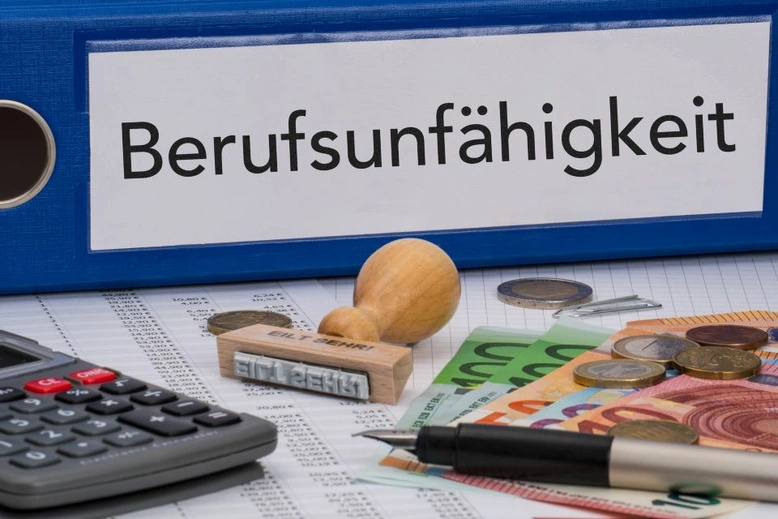
Auswüchse des Alterns, ein Unfall innerhalb oder außerhalb des Berufs. Schwere Krankheiten und immer häufiger psychische Probleme zwischen Burnout und schweren Depressionen: Es gibt mannigfaltige Gründe, die einen Menschen davon abhalten, bis zum eigentlichen Renteneintrittsalter am Erwerbsleben teilzunehmen. Da Deutschland ein Sozialstaat ist, gibt es dafür genaue Regelungen. Doch diese unterliegen vielen Hürden, Untersuchungen und Diagnosen. Der folgende Artikel will deshalb eine Handreichung sein, die diese Schritte auflistet und verständlich erklärt.
1. Begrifflichkeiten
Beim Thema Frührente werden viele Begriffe häufig durcheinandergeworfen und nicht korrekt verwendet. Allerdings liegt das auch daran, dass das System in Deutschland mehrfach verändert wurde.
Berufsunfähigkeit(srente) ist der am häufigsten verwendete Begriff – allerdings meistens falsch, denn er betrifft, zumindest was die staatlichen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung betrifft, nur einen alljährlich kleiner werdenden Personenkreis. Präziser formuliert nur Personen, die bis einschließlich 1. Januar 1961 geboren wurden. Berufsunfähigkeit wird diesem Personenkreis immer dann zugesprochen, wenn sie für mindestens sechs Monate ihren zuletzt sozialversicherungspflichtig ausgeübten Beruf nicht mehr wahrnehmen können. Einfaches Beispiel: Ein Elektroinstallateur, der aufgrund eines Unfalls im Rollstuhl landet. Das gilt auch dann, falls theoretisch noch die Möglichkeit vorhanden wäre, einen anderen Beruf voll auszuüben.
Erwerbsminderung(srente) betrifft alle Personen, die ab dem 2. Januar 1961 geboren wurden. Sie ist wesentlich straffer geregelt und nimmt keine Rücksicht auf ausgeübte oder erlernte Berufe, sondern nur die tatsächlich noch vorhandene Restfähigkeit (oder Unfähigkeit), in den kommenden sechs Monaten irgendeinen Beruf auszuüben. Der erwähnte Elektroinstallateur konnte beispielsweise noch Vollzeit Büroarbeit ausführen und wäre dementsprechend gar nicht erwerbsgemindert. Diese Rente teilt sich auf in teilweise Erwerbsminderung, in diesem Falle sind Betroffene noch fähig, drei bis sechs Stunden täglich irgendeinen Beruf auszuüben sowie vollständige Erwerbsminderung. Hierbei dürfen Betroffene nicht fähig sein, mindestens drei Stunden täglich irgendeinem Beruf nachzugehen. Wichtig: Beide Rentenformen können auch zeitlich befristet werden
Daraus ist ersichtlich, dass Jahr für Jahr weniger Menschen in den „Genuss“ einer echten Berufsunfähigkeitsrente kommen – 2018 steht der Jahrgang 1955 zur Verrentung an, 2026 wird es dann niemanden mehr geben, der auf klassische Berufsunfähigkeit pochen kann.
Allerdings sei angemerkt, dass sich diese Punkte nur um die staatlichen Leistungen drehen. Im Rahmen privater Zusatzversicherungen gibt es durchaus „Berufsunfähigkeit“ auch für jüngere Jahrgänge. Zudem gilt, „nichts ist für die Ewigkeit“. Auch bei einer offiziell dauerhaften, unbefristeten Erwerbsminderung wird man in unregelmäßigen Abständen gegenüber der Rentenversicherung durch Beantworten von Fragebögen und Einsenden aktueller Befunde den Nachweis immer wieder erbringen müssen.
2. Faktor Einzahlungsdauer
Ein großes Problem für viele ist dabei die Tatsache, dass die Erwerbsminderungsrente auch daran gekoppelt ist:
- dass der Betroffene in den letzten fünf Jahren für mindestens drei Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgegangen sein muss.
- dass der Betroffene insgesamt mindestens fünf Jahre rentenpflichtversichert gewesen sein muss.
Allerdings gibt es auch Ausnahmen, die vor allem Berufsanfänger schützen sollen. Würde ein junger Azubi am Ende des zweiten Lehrjahres durch einen Unfall erwerbsgemindert, bekäme er trotzdem die staatliche Rente. Für Berufseinsteiger gilt die Sonderregel, dass sie nur innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens ein Jahr eingezahlt haben müssen.
Jedoch auch mit einem Passus: Das gesamte System verläuft nach dem Prinzip „Reha vor Rente“. Das bedeutet, bevor Ansprüche gewährt werden, müssen (auf Kosten der Rentenversicherung) erst Rehabilitationsmaßnahmen wahrgenommen werden.
3. Der Kampf
Knapp zwei Millionen Deutsche beziehen zurzeit Erwerbsminderungsrente. Und tatsächlich ist der Kampf, den man zur Erlangung dieser geringen Summen (Volle Erwerbsminderungsrente alte Bundesländer durchschnittlich 771€/Monat) ein sehr umfangreicher.
Am Anfang steht ein Mediziner. Er wird die Diagnose stellen, dass vermutlich aufgrund Krankheit eine Erwerbsminderung vorliegt. Das ist jedoch nur der Ausgangspunkt. Als nächstes benötigt man eine der wichtigsten Zahlen, die ein Deutscher haben kann, seine zwölfstellige Rentenversicherungsnummer. Sie ist für jeden einzigartig, dient gegenüber dem Rentenversicherungsträger als Identifikationsmerkmal und ändert sich zeitlebens nicht.
Mit dieser Nummer und der Diagnose kontaktiert man nun oder lässt kontaktieren, seinen Rentenversicherungsträger. Wichtig: als Mitglied der GKV hat man Anspruch auf 72 Wochen Krankengeldauszahlung. Diese sollten vor der Antragstellung großzügig ausgeschöpft werden. Ebenso sollte bei älteren Menschen genau geprüft werden, inwieweit es auch möglich wäre, statt der Erwerbsminderungsrente die Rente mit 62 zu erlangen – das kann unter Umständen und Ausnutzung der Krankengeldauszahlung die langfristig bessere, zumindest einfachere Möglichkeit sein. Es zählt dabei jedoch immer der Einzelfall.
Generell wird seit 2014, falls das Mindest-Renteneintrittsalter noch in weiter Ferne liegt, im Rahmen der Zurechnungszeit eine (natürlich theoretische) Einzahlung in die Rentenversicherung bis 62 angenommen. Im Klartext: Die Höhe der vollen Erwerbsminderungsrente ist unabhängig vom tatsächlichen Lebensalter genauso hoch, als wenn man regulär bis 62 gearbeitet hätte, aktuell entspricht das einem Abschlag von etwa zehn Prozent. Bis 2024 soll diese Zeit übrigens bis auf 65 Jahre angehoben werden, womit die Summen steigen.
Hat man die Formulare auf den Weg gebracht, wird die Rentenversicherung nun zunächst die theoretischen Ansprüche aufgrund der Versicherungsdauer prüfen. Wurden diese positiv beschieden, wird sie einen anschließend bitten, bei einem Amtsarzt vorstellig zu werden.
Ein enorm wichtiger Termin. Denn hierbei wird offiziell festgestellt:
- Ob tatsächlich eine Erwerbsminderung vorliegt
- Wie stark die Erwerbsminderung aktuell ist
- Welche Möglichkeiten einer Reha in Betracht kommen
- Wie sich eine solche auf ein mögliches späteres Erwerbsminderungslevel auswirken könnte
Viele Experten raten dazu, schon vor diesem Termin einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Nicht ohne Grund, von der Drittelmillion Anträgen jährlich werden nur gut die Hälfte in irgendeiner Form positiv beschieden. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, sollte nicht zögern und dieses offizielle Gutachten anfechten, konkret: Widerspruch einlegen – und das binnen Monatsfrist.
Sollte auch dieser Versuch scheitern, ist es möglich, den Klageweg zu beschreiten. Das hat den Vorteil, dass dann erstmalig ein neutraler Gutachter ins Spiel gebracht werden wird. Wichtig: Falls das gesamte Prozedere die Krankengeldansprüche überschreitet, sollte die Arbeitsagentur konsultiert werden, auch wenn man noch beschäftigt ist.
4. Wenn es nicht reicht
Die gute Nachricht: Ein Großteil aller bewilligten Anträge enthält die volle Erwerbsminderungsrente. Allerdings reicht selbst die, wie oben aufgezeigt, in ihrer Summe selten zum Leben.
Wissenswert ist dabei, dass man in beiden Formen als Erwerbsminderungsrentner Anspruch darauf hat, sich legal ein Zubrot zu verdienen:
- Bei voller Erwerbsminderungsrente beträgt die Summe fest maximal 6300€ pro Kalenderjahr.
- Bei teilweiser Erwerbsminderungsrente wird ein komplizierter Schlüssel angewendet, der sich auf das höchste beitragspflichte Jahreseinkommen der letzten 15 Jahre vor der Erwerbsunfähigkeit bezieht
Sollte dies nicht reichen, bleibt als zweiter Weg der zum Amt. Entweder direkt oder via der Rentenversicherung. Ziel ist es, Aufstockleistungen, genauer, Grundsicherung zu beantragen. In diesem Falle läuft das Prozedere ganz genau so ab, als wäre man ein regulärer Altersrentner, dessen Auszahlung nicht zum Leben reicht. Auch hierbei wird wieder nach persönlichen Berechnungsschlüsseln vorgegangen. Als Faustregel kann man sich jedoch merken, dass theoretisch immer dann Ansprüche bestehen, wenn die monatlichen Einkünfte einen Betrag von 775 Euro nicht überschreiten. Für Alleinstehende kämen dann in der Regelbedarfsstufe-1 416 Euro monatlich hinzu, in Bedarfsgemeinschaften senkt sich der Betrag auf 374 Euro.
5. Private Zusätze
Alles, was bisher beschrieben wurde, bezieht sich auf die offiziellen Leistungen, die jedem Arbeitnehmer zur Verfügung stehen – selbst mit Grundsicherung ist das oft genug weit von „ausreichend“. Daher sei jedem, auch GKV-Versicherten, dringend angeraten, zusätzliche private Vorsorge in Form von Berufsunfähigkeitsversicherungen zu betreiben. Zumindest, wenn man in Branchen arbeitet, die ein geringes Risiko aufweisen, kann man diese schon für niedrige zweistellige Zahlungen pro Monat bekommen.
Die genauen Umstände variieren zwar zwischen den einzelnen Anbietern und Verträgen. Generell greifen jedoch die meisten privaten Zusatzversicherungen dann, wenn ein Gutachter der Versicherung (unabhängig vom Urteil des Amtsarztes) zu dem Schluss kommt, dass eine mindestens fünfzigprozentige Berufsunfähigkeit vorliegt. Und eine solche Versicherung sollte man auch so früh wie möglich abschließen, weil dann die Beiträge teils massiv geringer sind, als in späteren Einstiegsjahren.
